Befreiung aus narzisstischen Verhältnissen
„Sich Hilfe zu suchen, ist der Wendepunkt.“ Ein Gespräch mit der Traumatherapeutin Sonika Husfeld-Suethoff, wie die Ablösung von narzisstischen Eltern gelingen kann und warum sie bei vielen Kriegsenkeln das Leiden darunter erlebt.
 Sie arbeiten als Traumatherapeutin. Wie zeigt sich bei Ihren Klient:innen die Herkunft aus einem narzisstisch geprägten Elternhaus?
Sie arbeiten als Traumatherapeutin. Wie zeigt sich bei Ihren Klient:innen die Herkunft aus einem narzisstisch geprägten Elternhaus?
Menschen, die in dieser Umgebung aufgewachsen sind, wurden von Mutter oder Vater als Verlängerung ihres Selbst empfunden und behandelt. Sie wurden nicht geliebt für das, was sie waren, sondern dafür, was sie zu sein hatten. Nur für diese Funktion haben sie Liebe und Aufmerksamkeit bekommen, nicht für ihr Wesen, ihr Selbst. Deswegen fällt es ihnen sehr schwer, ihre eigene Identität und ein stabiles Selbstwertgefühl zu entwickeln. Das zeigt sich dann in Tendenzen zur Selbstentwertung. Und ich erlebe große Schwierigkeiten, sich aus der Familiendynamik zu lösen.
In einem Kriegsenkel-Seminar berichtete eine Frau davon, dass ihre Mutter selbst ihre guten Noten in der Schule für sich selbst reklamierte. Mit der Aussage: „Ohne mich hättest du das nicht geschafft!“ Welche Vereinnahmungen erleben Sie?
Die unterschiedlichsten. Eine Klientin litt sehr darunter, dass ihre Mutter ihr gegenüber keine Grenzen kannte. Sie wurde von klein auf überschüttet mit allem Leid, das ihre Mutter erlebte, und konnte dem auch später keinen Einhalt gebieten. Irgendwann gelang ihr der Auszug von zu Hause, aber das Leiden ging weiter. Denn ihr mangelndes Selbstwertgefühl machte es ihr schwer, Kontakt zu anderen Menschen aufzubauen, sie fühlte sich einsam und allein.
Ist das Phänomen bei Kriegsenkeln besonders ausgeprägt?
Dazu kann ich keine allgemeinen Aussagen machen. Aber ich erlebe in meiner Praxis viele Menschen aus dieser Generation. Wenn wir uns die Bedingungen anschauen, unter denen viele Kriegskinder – also deren Eltern – aufwachsen mussten, dann begünstigte das auf jeden Fall die Ausprägung narzisstischer Eigenschaften. Und entsprechend oft leiden ihre Kinder, die Kriegsenkel, unter den Folgen.
Sind auch sogenannte Helikopter-Eltern, die sich ja maximal um das Fortkommen ihrer Kinder kümmern, ein Teil des Phänomens?
Auch hier können die Kinder eine Verlängerung des eigenen Egos sein. Es ist zumindest möglich, dass Helikopter-Eltern ihre Kinder gar nicht richtig wahrnehmen, sondern ihre eigenen Bedürfnisse in ihnen realisiert sehen wollen. Solange die Kinder klein sind, ist das weniger dramatisch, weil die Eltern ihnen ja viel Aufmerksamkeit schenken. Problematisch wird es, sobald sie als Jugendliche Autonomie entwickeln und in die eigene Wesenskraft kommen wollen. Narzisstische Elternteile unterbinden das. Die Botschaft ist: „Du kannst nur an meiner Seite leben, wenn du bist, wie ich dich brauche.“ Sie kann aber auch heißen: „Wenn du mich verlässt, bringe ich mich um.“
Welche Aufgabe hat diese narzisstische Inanspruchnahme der Kinder?
Sie soll kompensieren, was Mutter oder Vater als eigenen Mangel empfinden. Laurence Heller, der Begründer der Therapiemethode NARM („Neuro Affective Relational Model“), hat dafür ein treffendes Bild entwickelt: Es ist, als sage die Mutter zu ihrem Baby: „Wenn du dich maximal um meine Bedürfnisse kümmerst, wenn du genau das tust, was ich von dir erwarte, wenn du erreichst, was ich immer erreichen wollte: Dann – und nur dann! – werde ich dich als mein Kind anerkennen, dich vielleicht sogar lieben.“
Wir stellen uns ein kleines Kind vor, das mit diesen Erwartungen konfrontiert wird.
Es hat keine Chance zu entkommen. Weil es um sein Überleben geht, wird es sich vollkommen darauf einschwingen. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie empfindsam schon Säuglinge diese Signale aufnehmen und verarbeiten.
Das ist doch tieftraurig.
Absolut. In der Therapie braucht es sehr viel Mitgefühl für das Leid, das darunter liegt. Aber es braucht auch sehr viel Kraft für eine Konfrontation. Weil auch Gefühle von Beschämung und Demütigung hervorkommen – was für die Betroffenen sehr unangenehm ist, weswegen sie sich mit Wut und Aggression zu beschützen versuchen. Das ist dann ein gutes Zeichen: Individuation und Separation haben begonnen.
Was ist damit gemeint?
Individuation und Separation beschreiben die natürliche Entwicklung eines jungen Menschen, der eine eigene Identität entwickelt und sich dann von den Eltern ablöst, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Kinder von narzisstischen Eltern können das nicht oder nur eingeschränkt, weil die Distanz mit massiven Existenzängsten verbunden ist – es hätten sich schwarze Löcher aufgetan. In der Therapie geht es heute darum, die Ressourcen zu aktivieren, mit deren Hilfe die Ablösung dann gelingt.
Ist das ein Ergebnis eines längeren Prozesses?
Es braucht viel Zeit und Geduld, den Betroffenen den Raum zu geben, in dem sie sich selbst finden können, sich selbst mögen lernen, auf die eigenen Füße kommen und wirklich frei sein können. Selbstliebe und Selbstwert müssen nachgenährt werden. Auch das Leid, das dahintersteht, muss gewürdigt sein
Zeigt sich das bei Töchtern und Söhnen unterschiedlich?
Es mag sein, dass es gesellschaftlich bei Frauen als selbstverständlicher akzeptiert wird, dass sie narzisstischen Eltern unterliegen, hier vor allem den Müttern. Mir kommt es auch so vor, als würden sich manche Frauen dieser Rolle leichter ergeben. Aber das Leid ist dasselbe, und die Demütigungen sind deswegen nicht weniger schmerzhaft.
Wenn jemand Sie fragt, was sie oder er denn jetzt tun solle, wie er sich abgrenzen könne: was antworten Sie?
(lacht) Dann sage ich, dass unsere Arbeit nicht das Ziel hat, etwas zu tun. Es darum geht herauszufinden, was der Abgrenzung im Weg steht. Ich kann keine Tipps geben. Das würde keinen Sinn machen. Ratschläge, wie man sich abgrenzen kann, gehen in aller Regel ins Leere. Sie können sogar die Verzweiflung steigern, wenn sie für die Betroffenen nicht umsetzbar sind. Stattdessen schauen wir die Befürchtungen an: Welches könnte die größte Katastrophe als Folge einer Abgrenzung sein?
Zum Beispiel, dass die Mutter sich tatsächlich umbringt?
Diese Befürchtung kann es geben. Aber sie beruht erst einmal nicht auf einer heutigen Wahrnehmung der Situation, sondern auf dem Mutter-Introjekt, das aus früher Kindheit stammt. Dann lade ich dazu ein, dieses Introjekt zu aktualisieren. Dazu ist oft Konfrontation nötig, ein hartnäckiges Dranbleiben an der Frage: „Was passiert wirklich, wenn du deine Mutter heute nicht anrufst, sondern erst wieder in einer Woche?“
Was würde passieren?
Zumeist eskalieren die Vorwürfe. Oder eine Bestrafung folgt, ein Liebesentzug etwa. Darin kommt die Kälte der Narzisst:innen zum Vorschein. Auch dem erwachsenen Kind ist sofort klar: „Ich bin schuld.“ Das fühlt sich so unangenehm an, dass der Mensch in diesem Moment unser Mitgefühl braucht, unsere emotionale Unterstützung. Dass wir einfach da sind, übrigens ohne gute Ratschläge. Bleibt er alleine damit, wird er sich der Macht des Elternteils irgendwann wieder unterwerfen.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen aus narzisstisch geprägten Familien auch in anderen Lebensbereichen Narzissmus erleben?
Sehr hoch. Sowohl bei der Wahl des Partners als auch beim Verharren in narzisstisch geprägten Arbeitsverhältnissen. Übrigens auch bei narzisstisch geprägten spirituellen Gruppen. Sie suchen dort eine Förderung ihres Selbstwerts, eine emotionale Heimat und treffen auf Lehrer, die ihnen eine ganz ähnliche Botschaft vermitteln wie zuvor Mutter oder Vater: dass sie sich unterordnen und anstrengen müssen, dass sie es noch nicht wert sind, anerkannt oder geliebt zu werden.
Welche Rolle spielen bei der Ablösung aus einer narzisstisch geprägten Beziehung – ob Familie, Partner oder Arbeitsplatz – andere Menschen?
Eine entscheidende. Wenn das Eingeständnis gelingt, dass ich Hilfe brauche, ist ein bedeutender Schritt getan. Das kann der Wendepunkt sein, der Beginn eines Prozesses von Separation und Individuation. Von hier an geht es nicht mehr um den oder die Narzisst:in. Von hier geht es um das eigene Bedürfnis, die eigene Kraft.
 iStock
iStock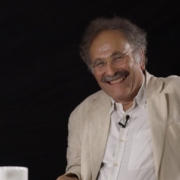

 iStock
iStock iStock
iStock
 Getty
Getty Getty
Getty iStock
iStock
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!